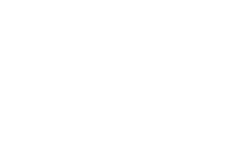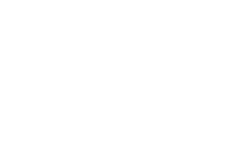Lieben Sie Schumann?
Sir András Schiff im Gespräch mit Prof. Dr. Bernhard Appel
Schumann-Forum-Veranstaltung am 6. Juli 2016 im Schumannhaus Bonn
* Leicht gekürzte Mitschrift des Gesprächs, als Video auf YouTube eingestellt: https://www.youtube.com/. Die Textübertragung übernahm Eve Nipper, Firma Pergamon, das Lektorat Ingrid Bodsch. In [ ] gesetzte Angaben wurden nachträglich von Ingrid Bodsch eingefügt. [...] bezeichnen eine Auslassung im Text. ... bedeuten eine signifikante Pause im Gespräch. (I.B.)
A: Lieber Maestro Schiff, herzlich willkommen und vorab schon vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich auf dieses Gespräch hier einzulassen. Ein Gespräch über Schumann an einem geschichtsträchtigen Ort, der sicherlich inspirierend wirkt. Ich bedanke mich nochmals ausdrücklich bei meinen beiden ehemaligen Kollegen Frau Kämpken und Herrn Ladenburger, dass sie wirklich die Mühe auf sich genommen haben, eine kleine Sonderausstellung hier zu installieren und ich wünsche mir, dass Sie [– ans Publikum gerichtet – ]sich diese Objekte, die aus dem Bestand des Beethovenhauses hier in den beiden Vitrinen zu sehen sind – alles Schumaniana –, später ansehen und vielleicht können wir auch im Gespräch auf das ein oder andere Objekt Bezug nehmen.
Maestro Schiff, ich muss Sie nicht fragen – wie der Reihentitel heißt – „Lieben Sie Schumann?“ Das haben Sie hinlänglich wirklich bewiesen. Sie haben einen enzyklopädischen Zugriff auf die Schumann‘sche Musik, nicht nur auf die Klaviermusik, sondern auch auf die Kammermusik, die Konzerte natürlich und Sie haben Lieder eingespielt mit Herrn Schreier und Robert Holl, das heißt einen ungeheuren Erfahrungsschatz, über den wir Näheres wissen wollen, über Ihre Erfahrung, über Ihren Umgang mit dieser Musik.
Die erste Frage, die wahrscheinlich alle interessiert, wann kamen Sie zum ersten Mal mit Schumann in Berührung, über welche Werke und was hat das für Sie ausgelöst, bewirkt?
S: Das kam sehr früh mit etwa sechs, sieben Jahren. Es ist ja wunderbar, dass Robert Schumann auch an die Kinder gedacht hat wie an das Album für die Jugend. Wenn man etwa Violine spielt oder andere Instrumente, die viel schwerer sind als das Klavier, wenn Kinder Musik studieren, das sollte eine Freude sein und nicht schwere Arbeit und keinen Pflicht und dann wir sind als Pianisten sehr glücklich, dass Komponisten wie Johann Sebastian Bach, wie Wolfgang Amadeus Mozart und nicht zuletzt Robert Schumann wunderbare Originalstücke für Kinder komponiert haben. Also das kann man schon ziemlich früh spielen die ersten Stücke aus dem Album für die Jugend,. [Wenn man] dagegen [...] Geige spielt oder Cello oder andere Instrumente, dann spielt man sehr oft nicht sehr gute Musik ... , etwa Etüden ... Das tut man auf dem Klavier auch, schreckliche Etüden von Czerny, Fingerübungen von Hanon, aber dann ist es wunderbar, diese Schumann-Stücke zu spielen und da ist schon diese ganze Poesie drin und diese wunderbare poetische musikalische Sprache und ich habe das sofort geliebt ... heiß und innig. Und das ist geblieben, ein Leben lang bis heute und hoffentlich so lange wie ich lebe, es bleibt diese ganz enge Beziehung zur Schumann´schen Musik.
A: Zum Album für die Jugend gehört ja – das war das didaktische Konzept von Schumann – auch dieses Konvolut von mehr als 60 musikalischen Haus- und Lebensregeln. Haben die damals auch schon eine Rolle gespielt für Sie oder kamen Sie damit später in Verbindung?
S: Das kam viel später, also die Beschäftigung mit der ganzen literarischen Welt. Und was auch wichtig für mich war, dass ich schon als Kind Deutsch gelernt habe dank meinen Eltern, die auch deutsch gesprochen haben. Aber das war damals noch in Ungarn aus der k. u. k. Zeit üblich, dass man das pflegte. Also ich hatte dann, das war zwar [schon] das kommunistische Ungarn, [...] Privatunterricht auf Deutsch. Und das war sehr wichtig, weil ich glaube, dass man die Schumann‘sche Musik ohne Deutschkenntnisse und ohne eine Beziehung zur Literatur ... [nicht ganz versteht]. Das ist sonst eine halbe geschlossene Welt. Ich weiß nicht, wie das andere machen, die kein Wort Deutsch können ... Ich bedauere sie.

A: Ich glaube, wir kommen auf den Punkt nochmal zurück. Die Stücke aus dem Album für die Jugend haben Sie bisher noch nicht eingespielt ...
S: Nicht eingespielt, aber ich spiele das immer für mich zu Hause ...
A: Dürfen wir hoffen?
S: Wir dürfen hoffen ...[lacht] ... Ich möchte das unbedingt jetzt einspielen und zwar auf einem historischen Instrument. Ich weiß noch nicht, was für ein Instrument genau, aber ich hab schon manche Ideen.
A: Ein kleiner Zwischenhinweis ... In der Vitrine hinter mir sehen Sie die Urschrift des Albums für die Jugend, ein kleines Heft, das Schumann angelegt hat für den 7. Geburtstag seiner kleinen Tochter Marie. Das ist eine Sammlung von kleinen Stücken, sechs davon sind dann in das Album wirklich eingegangen. Das war die Kernidee und Schumanns Gedanke war und das kann man an diesem Heft gut sehen, noch einen Gang durch die Musikgeschichte zu machen mit einer Auswahl von kleinen Stücken, beginnend bei Händel und Bach bis hin zu seinen Zeitgenossen Mendelssohn und Spohr. Nicht alle Pläne sind verwirklicht. Haben Sie vor, wenn Sie die Einspielung machen, das zu verknüpfen?
S: Ja, wenn schon denn schon ... [lacht, Publikum lacht] ... ja natürlich, das ist auch sehr wichtig dieses erzieherische bei Schumann, das pädagogische. Das ist wieder diese Idee, seine eigene Musik, seine besten Stücke für Kinder zu schreiben, aber auch, dass die Kinder eben mit der besten Musik aus der Vergangenheit aufgezogen werden. Also Bach vor allem [...] Da bin ich auch Schumann gefolgt bis heute, das Wohltemperierte Klavier ist mein tägliches Brot, jeden Tag.
A: Sie haben eben gerade den literarischen Bezug zu Schumann betont ... es gibt sehr viele offene literarische Bezüge, ich denke zum Beispiel an das Gedicht, das der Fantasie voran gestellt ist, von Friedrich Schlegel, oder auch an die Verse von Hebbel, die „Verrufene Stelle“ in den Waldszenen und es gibt sehr, sehr viele Titel, die narrativen Charakter haben, Kinderszenen, Ballszenen, „Scènes mignonnes“, alles assoziationsträchtige Titel und wir wissen, dass Schumann sehr viel Wert darauf legte, dass diese Titel im Nachhinein zu seiner Musik kamen ... Das stimmt nicht immer ganz, das lässt sich nachweisen an einigen Handschriften. Das ist aber auch vielleicht gar nicht so wesentlich. Meine Frage ... Welche Rolle spielen für Sie diese literarischen Anspielungen – Papillons, Flegeljahre von Jean Paul etwa – für Sie etwa in der Interpretation?
S: Eine enorm wichtige Rolle. Wie gesagt, ohne diese Assoziationen wäre diese Musik nicht realisierbar. Es ist keine abstrakte Musik. Und diese Assoziationen sind eine enorm große Hilfe für uns Interpreten. Mein Gott, wir ..., also ich bin sowieso ein assoziativer Mensch und stelle mir Metaphern und Bilder vor, aber das möchte ich nicht immer mit den Zuhörern teilen [schmunzelt]. Das ist eine private Angelegenheit, weil das ist auch das Schöne an der Musik, dass es eine freie assoziative Kunst ist. Also ich muss Ihnen ja nicht vorschreiben, woran Sie jetzt denken müssen. [Publikum lacht] Gott sei Dank. Aber es gibt schon Kategorien. Also heutzutage ist nichts selbstverständlich in der Musik. Leider sind wir so weit gekommen in der Musikkultur, dass sich ein Publikum manchmal fragen muss, ist das ein tragisches Stück oder ein komisches Stück. [Publikum lacht] [...] Also für mich ist das selbstverständlich, zum Beispiel, wo ein Beethoven-Stück komisch ist ... oder ein Haydn-Stück. Haydn ist ja der Großmeister des Humors. Aber sehr viele Menschen, sehr viele hier in Deutschland – es tut mir leid, das zu sagen, [Publikum lacht] – [glauben, dass] das Lachen im Konzert verboten ist. Es ist immer todernst. Aber bitte, Humor ist etwas großartiges und Humor ist etwas sehr ernstes. [Publikum lacht].
Aber Schumann hilft uns ja, etwa in Davidsbündlertänze, wo er dann vorschreibt „mit gutem Humor“ ... ja, nicht einmal mit schlechtem Humor. [lacht, Publikum lacht] Und das ist irrsinnig lustig. Oder eben dort ist auch ein Stück „wild und lustig“ im zweiten Heft in Davidsbündlertänze [...] Diese Vorschriften von Schumann oder ein Motto von Schumann – es ist mir eigentlich unverständlich, dass man so oft [...] diese literarischen Vorschriften oder Mottos von Schumann [...] in der Erstausgabe hat und später hat er sie dann ausgestrichen. Wissen Sie warum?
A: Nein.
S: Ich auch nicht. [Publikum lacht] Und ich bedauere das sehr. Weil eben, wenn er schreibt etwa „ganz zum Überfluss“, also am Ende von Davidsbündlertänze, „‚Ganz zum Überfluß meinte Eusebius noch Folgendes; dabei sprach aber viel Seligkeit aus seinen Augen“ – also das ist so wunderbar. Und wenn ich das vielleicht vorspiele ...
[Steht auf und geht zum Klavier, fängt an zu spielen]. Das ist das vorletzte Stück und jetzt kommt dieses „Ganz zum Überfluss“ ... [spielt weiter, den letzten Tanz, an dessen Ende zwölf Schläge der Turmuhr – durch Repetition des Tons C angedeutet – das lustige Treiben beenden.] Und ohne dieses Motto, das wäre etwas ganz anderes. Mir sind sie eine große Hilfe, diese poetischen Instruktionen von Schumann. Und alles ist symbolisch, daher klingt zum Beispiel das Kontra C zwölfmal, also es ist Mitternacht, es kommt zwölfmal dieses tiefe C, das ist doch kein Zufall.
A: Aber es gibt natürlich auch [andere] Bezeichnungen – Ich denke jetzt an Spielanweisungen wie „quasi Oboe“ im Klaviersatz ...
S: Ja, das ist wunderbar. Die [...] ersten 24 Opusnummern von Schumann sind alle Klavierwerke, ohne Ausnahme. Und trotzdem, er schreibt für das Klavier ganz eigenartig, also es ist eine ganz neue Art, für das Klavier zu schreiben. Aber es ist sehr oft auch orchestral, denken wir an die F-Moll-Sonate, Untertitel Konzert ohne Orchester ... und da eben in der Fis-Moll-Sonate, da kommt diese Passage „Wie eine Oboe“. Also das ist auch assoziativ und ich versuche ja auch immer so Klavier zu spielen, dass es nicht wie ein Klaver klingen soll. [Publikum lacht] Um Gottes Willen nicht. Alles andere, manchmal orchestral, manchmal wie ein Cello, manchmal wie eine Oboe ... und vor allem wie die menschliche Stimme. Das ist ein Irrtum, wenn manche Leute denken, das Klavier sei ein Schlaginstrument. Das wird leider von vielen Leuten, besonders in der heutigen Zeit, sehr oft geschlagen. Aber wenn Sie den Flügel schlagen, schlägt er zurück. [Publikum lacht]. Aber brutal. Und eben das ist die Kunst des Klavierspielens, der Zuhörerschaft irgendwie die Illusion zu geben, dass es kein Klavier ist. Dass es ein Orchester ist oder dieses Instrument oder jenes ... es ist ein singendes, sprechendes Instrument. Und das hat Robert Schumann wunderbar gemacht und gewusst. Er wollte auch – wir wissen es alle –, er wollte Pianist werden und dann hat er seine Hände malträtiert und dann vielleicht hat ihm das viel Traurigkeit gegeben, dass er seine pianistischen Träume nicht verwirklichen konnte. Aber das lebt er dann weiter in Claras Kunst und in seinen Kompositionen. Also er ist ein fantastischer Klavierkomponist unter anderen.
A: Sie kamen eben schon auf die Besonderheiten der Schumann´schen Klangsprache, die ist natürlich sehr schwer zu beschreiben. Aber ich möchte vielleicht einen Aspekt heraus greifen, der in Ihren Interpretationen, glaube ich, eine ganz eminente Rolle spielt, nämlich die Rolle der sogenannten Mittelstimmen, Füllstimmen. Es ist ja so, um es ganz kurz zu beschreiben, dass die melodischen Kerne, Motive, Themen oft so verwoben sind in die Füllstimmen und dadurch eine permanente Charakterverwandlung erfahren, dass die schlichte Melodie sozusagen durch die Nebensache, nämlich durch die Füllstimmen verzaubert wird. Das ist eine pianistische Herausforderung stelle ich mir vor, ein Aspekt Ihrer Interpretation, der für mich ganz sinnfällig ist. Wie lernt jemand diese Art des analytischen Spielens? Denken Sie analytisch?
S: Ja, sehr. Ich denke analytisch. Allerdings im Augenblick einer Aufführung, im Konzert muss man das Analytische vergessen. Das ist wieder eine private Sache. Man muss im Musikzimmer zu Hause, beim Üben, beim Studieren, da muss man analysieren, aber das Publikum möchte keine Analyse hören, denke ich. Also man kann zu einem Vortrag kommen und Sie machen eine Analyse ... [aber beim Konzert?], da wird das sonst wie beim Psychiater?![Publikum lacht] Das wollen die Leute nicht ..., nicht wahr? [schmunzelnd ans Publikum wendend]. Ich weiß nicht, ich glaube nicht. So, Analyse und Integration. Man muss diese Elemente integrieren [...] Schumann ist ein sehr gutes Beispiel, weil alles so „improvisativ“ klingt [...], dabei ist es unglaublich genau konzipiert. Und trotzdem in der Aufführung, da muss man eben [...] das Improvisative vermitteln können, das ist sehr wichtig. Und was Sie gefragt haben wegen den Mittelstimmen –mein großer Lehrmeister ist und bleibt da Johann Sebastian Bach, die Polyphonie. In einer Bachfuge gibt es nicht so etwas wie Melodie und Begleitung. Es gibt Stimmen und diese Stimmen sind gleichberechtigt. Man darf eine Bachfuge nicht didaktisch vorspielen, jetzt bringe ich das Thema aus ..., das wäre dumm. Weil jeder kennt schon das Thema. Man muss alle Stimmen beachten. Natürlich, das ist vielleicht auch eine Illusion, weil wir sind alles Menschen ... ich weiß nicht, auf wie viele Dinge können Sie sich gleichzeitig konzentrieren?
A: Nicht allzu viel.
S: Doch, sicher. Na ja, das ist unterschiedlich. Also ich gestehe, ich konzentriere mich auf einmal auf eine Sache ... [Publikum lacht] ... und die anderen kommen mit. Aber trotzdem, bei Bach ist es so, dass man keine Stimme vernachlässigen darf. Und ich glaube, dass alle diese großen Meister und Schumann auch, die sind alle Schüler von Bach. Im besten Sinne! Und die Schumann´sche Musik ist unglaublich polyphon. Da spielen auch die Stimmen und die Stimmführung eine sehr wichtige Rolle. Allerdings, das ist dann nicht mehr so wie bei Bach, es gibt sehr oft Haupt- und Nebenstimmen und eben Mittelstimmen. Aber das muss man [spielen] [steht auf und geht zum Klavier]. Also wenn man sich hier nur auf die Melodie konzentriert, dann ist das sehr schön, aber sehr primitiv. Wenn ich [spielt weiter] etwas opernhaftes spiele, [...] Das ist so raffiniert, eben mit diesen Mittelstimmen ... Aber [steht auf und kehrt zu seinem Platz zurück] das Klavier ist ein polyphones Instrument. Und eben die Kunst ist, dass wir hier etwa sechs oder sieben Stimmen haben, sechs- oder sieben- oder achtstimmige Akkorde und man muss diese Stimmen mischen, balancieren. Kein Ton ist gleich so stark wie der nächste. Ich kann das Ihnen demonstrieren [steht auf und geht zum Klavier zurück], das so ein Akkord [spielt], acht Stimmen. Ich kann das so spielen [spielt weiter] [oder so]m je nachdem, welche Stimme [kehrt zu seinem Platz zurück] ich ein bisschen mehr heraus heben möchte. Das ist etwas, was Sie auf einem Cembalo nicht machen können. Aber damals wusste [das] jemand wie Bach oder Händel oder Scarlatti, die für Cembalo [komponierten], die Leute haben dann anders komponiert. Aber schon ab etwa 1770, 1780, schon mit den ersten Fortepianos waren diese dynamischen Nuancierungen möglich und machbar. Und da schreiben die Komponisten schon anders. Also eben bei Schumann muss man auch die polyphonischen Aspekte ganz genau beobachten. Das ist sehr wichtig. Natürlich, Pianisten und auch Zuhörer tendieren sehr nach oben zu gucken, auch in den bildenden Künsten. Architektur zum Beispiel. Man schaut immer auf den Turm einer Kirche, ohne zu denken, es muss auch ein Fundament [geben]. Ohne das würde dieser Turm nicht stehen. Und in der Musik, das Fundament ist immer auch unten. Bass ..., vom Bass aufbauen. Und die Obertöne dann aufblühen lassen.
A: Nochmal zur Klangsprache. Das Cembalo verfügte natürlich auch über keine Pedale, die große Errungenschaft des Pianoforte war ja die Entwicklung der Pedale und das Pedal spielt eine ganz große Rolle in der Musik Schumanns. Ich denke jetzt ganz konkret an die letzte Nummer der Papillons, da gibt es eine Stelle, fünfundzwanzig Takte lang, ein Orgel-Pedalton, den Sie halten, der hörbar ist ...
S : Ja ...
A: ... und dann kommt die berühmte Stelle am Schluss, ein siebenstimmiger Akkord, A-Dur, und der Klang wird subtrahiert, Sie heben das nacheinander auf, das A bleibt stehen, wird dann zur Quinte des Schlussakkords. Das ist ein Klangzauber, den Sie hier erzeugen. Meine Frage geht dahin – die modernen Klaviere haben eine perfekte Konstruktion im Pedalbereich. Ich denke, dass das eine wesentliche Rolle spielt, um überhaupt diese nuancierte Klangfinessen zum Ausdruck zu bringen. Wir wissen aber, dass Sie sich auch mit historischen Klavieren befassen, da sieht es ein bisschen anders aus ...
S: Ja, aber so anders ist es nicht. Natürlich der Klang ist anders, aber zum Beispiel – [auch] das ist eine geniale Idee von Schumann –, das [steht auf und geht zum Klavier] Ende von Papillons [spielt]. und jetzt kommt dieser siebenstimmige [Akkord] ... [spielt weiter]. Haben Sie gehört? Das ist wichtig ... so ... [spielt]. Eigentlich spielt das Pedal hier keine Rolle, aber man nimmt einen Ton nach dem anderen weg und es bleibt nur dieses A [spielt]. Also das ist vielleicht auch ein Symbol ... Hände weg, ja ...[kehrt zu seinem Platz zurück, Publikum lacht] ... Hände weg, von wem? Wissen Sie es? [sich an Bernhard Appel wendend]
A: Ich weiß es nicht.
S: Da gibt es auch Theorien ... von der Frau Carus vielleicht ... nein...? Könnte es nicht sein ...?
A: Meinen Sie....
S: Agnes Carus. Also ich habe schon solche Theorien gehört. Also, Hände weg ...
A: Einen ähnlichen Effekt gibt es ja in den Abegg-Variationen auch, die er ja dann im Nachhinein erst in einem Nachstich noch eingefügt hat, eine der vielen Neuerungen, die Schumann in die Klaviermusik gebracht hat. Aber bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei den Papillons. Wenn ich mich recht entsinne, haben Sie bei einer Gelegenheit gesagt, dass sei ein Schlüsselwerk der romantischen Klaviermusik.
S: Ja, das meine ich ..., ja wirklich!
A: Könnten Sie das uns ein bisschen erläutern?
S: Ja ... wieder ein von Literatur inspiriertes Werk, Flegeljahre von Jean Paul, Schlussszene „Larventanz“. Und es ist eine, eine [bestimmte] Art von Musik. Es ist keine Programm-Musik, aber unglaublich literarisch inspiriert und so etwas gab es in der Musik nie vorher meines Wissens nach. Und vor allem nicht in der Instrumentalmusik und nicht in der Klaviermusik. Und dann, gut, Opus 1, Abegg-Variationen, ein wunderbares Werk und sehr, sehr inspiriert, aber Variationen gab es schon früher, auch großartige Variationen. Aber so etwas wie Papillons, diese chamäleonartigen, ganz kurzen Vignetten ... Und eine Ballszene ... Und wirklich, die Stücke sind manchmal nur ein paar Sekunden lang und [haben] sehr unterschiedliche Tonarten und unterschiedlichen Charakter. [...] Es kommt ein Mensch ins Zimmer und tanzt etwas vor und dann verschwindet er. Dann kommt der nächste, kommen wieder ein paar. Und das ganze so weiter. Später hat Schumann dann Carnaval und noch größere Formate geschrieben, aber so etwas urgeniales wie Papillons ... Ich halte das wirklich für ein sehr, sehr wichtiges Werk. Wir werden davon bald eine Fassung spielen mit dem Salzburger Marionetten-Theater. Ich bin sonst sehr gegen Bearbeitungen, aber das ist eine wunderbare Gruppe und ich bin sehr, sehr interessiert dafür. Weil das sind eben Tänze ... Walzer und Polka und Polonaise und alle diese wunderbaren Tänze und dann kommt der Großvatertanz ... [summt]. Ja, was kann man noch über die Papillons sagen? Nicht viel. Man muss das hören. Das wird viel zu selten gespielt heutzutage.
A: Was Sie eben beschrieben haben, deckt sich mit einer Aussage Schumanns, der über die Papillons gesagt hat, die vernichten sich wechselseitig. Und er empfiehlt, zwischen den einzelnen Nummern ein Glas Champagner zu trinken ... [Publikum lacht, András Schiff schmunzelt]
S: Ja, das wäre gut. Aber dann kann ich nur nachher trinken. [Publikum lacht]. Der Schumann, der hätte das vielleicht gekonnt, auch zwischen den Stücken ...
A: Vielleicht darf ich hier, weil wir an diesem Ort sind, ganz kurz nur ergänzen: Als Schumann hier in der Klinik untergebracht war, hat er die Nummer 10 aus den Papillons noch mal aus der Erinnerung nachkomponiert, allerdings einen ganzen Ton tiefer. Ich glaube der Satz steht in B-Dur, das Erinnerungsnotat steht in C-Dur. Es ist auch nicht ganz identisch mit der Originalversion. Nur als Nebenbemerkung, weil wir uns hier sozusagen am Ort einer Wiedergeburt einer Nummer der Papillons aufhalten.
Sie haben eingangs schon über Humor gesprochen und eigentlich das Thema, was mir ganz besonders wichtig ist, schon ein bisschen vorweg genommen. Sie gehören zu den wenigen Pianisten, die Schumanns Humoreske spielen ...
S: Ja ... aber das sind schon manche ...
A: Es ist ein ungeheuer langes Stück und ich glaube, es ist auch eine ungeheure physische und mentale Herausforderung, das Stück zu spielen. Es ist fast tausend Takte lang, 1839 in Wien entstanden und es hat ja eine gewisse Schlüsselrolle gehabt, weil Komponisten diese Art von Satzstrukturen nachgeahmt haben. Da drin gibt es eine Stelle, mit der ich mich befasst habe vor langer Zeit. Die innere Stimme, was macht man mit der inneren Stimme? [...] Der Klaviersatz ist an der Stelle auf Dreisystem notiert und in der Mitte die Stimme ist als innere Stimme bezeichnet. Was heißt das und was bedeutet das spieltechnisch?
S: Die innere Stimme muss man nicht spielen ... [schmunzelt]
A: Ja, aber singen ...
S: Aber innerlich singen. Und innerlich hören. Und das kann man [...] hörbar machen. Aber was die innere Stimme spricht ... das ist wieder im poetischsten Sinne [gemeint] ... [steht auf und geht zum Klavier und fängt an zu spielen, summt]. Das muss man hören, aber nicht spielen. So etwa...[kehrt zu seinem Platz zurück] Aber ich weiß nicht, wie man das macht. [Publikum lacht] Ich denke einfach sehr intensiv an diese Stimme, hoffend, dass das [hörbar wird]..
A: Aber es im Grund genommen ein Appell, der an den Interpreten gerichtet ist und der eigentlich Hörerschaft verborgen bleibt, es sei denn, dass man es weiß.
S: Ja, hoffentlich ...
A: Auf der Ebene wie „quasi Oboe“, das nehmen Sie wahr, aber das Publikum muss es wissen.
S: [...] Das Klavier kann sehr vieles und darum ist es kein Zufall, dass [...] also nicht nur die größten Virtuosen wie Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, die ja fantastische Pianisten waren, aber auch Schubert, Schumann, Brahms [...] solche Werke fürs Klavier geschrieben haben. Und ich würde auch nicht das Klavier wählen als mein Lieblingsinstrument, ich mag das überhaupt nicht ... [Publikum lacht]. Ich würde sehr gerne Cello spielen, wunderbar. Aber was spiele ich nachmittags ...? [Publikum, Bernhard Appel lachen]. Es gibt kein Repertoire. Oder Horn ... das wäre wunderbar. Also [...] wenn ich Cello spielen könnte, dann würde ich immer Streichquartette spielen. Das würde mir das Leben retten [Publikum lacht]. Aber ich hab wirklich das Klavier gewählt wegen der Literatur. Wegen dieses einmaligen Repertoires. Das ist wirklich nicht vergleichbar mit allen anderen. Und das ist wirklich ein Instrument, was im Wohnzimmer stehen kann und es ist einfach da und da kann der Komponist kommen und da komponieren ... oder improvisieren und so weiter. Aber es gibt wirklich Dinge, die das Klavier nicht kann. Zum Beispiel ein perfektes Legato zu produzieren. Oder auf einem gehaltenen Ton ein Crescendo zu machen, was ein Sänger kann. [40:06 summt]. Das kann ich auf dem Klavier nicht. Weil ich spiele einen Ton auf dem Klavier, egal wie schön oder mit welcher Vorstellung, aber im Augenblick des Anschlags fängt es an ein Deminuendo zu machen und langsam aber sicher der Ton stirbt. Das gibts kein Pardon. Und trotzdem ... trotz aller dieser Mängel, man kann diese Illusion hertellen und das hat auch Schumann fasziniert. Dann später ja ...[...] ich spreche [jetzt] vor allem von dieser ersten Phase, dann wir werden später vom Spätwerk von Schumann sprechen. Ich finde, das ist ein schrecklicher Vorurteil zu sagen, ja, das Spätwerk von Schumann und wie verrückt das ist, [weil] mentale Verhältnisse da eine fürchterliche Rolle spielen. Ich finde vieles von dem Frühwerk von Schumann viel verrückter, also so etwas wie Kreisleriana, so etwas wie die Fis-Moll-Sonate, das ist etwas ganz zerissenes und oft eine zutiefst depressive Musik. Das finde ich in späteren Werken nie wieder. Und trotzdem – es steht bis heute dieses Vorurteil gegen das Spätwerk.
A: Darauf würde ich gerne noch mal zurück kommen, aber vielleicht darf ich mich nochmal auf die Humoreske beziehen. Schumann hat über Komik, also musikalische Komik, einen Aufsatz verfasst und wollte eigentlich auch eine Abhandlung über Humor schreiben, das hat er aber dann leider nicht getan. Was ist an der Humoreske humoristisch? Es ist ja nicht, dass er uns auffordert auf die Schenkel zu klatschen oder laut zu lachen ...
S: Nein, das nicht ...
A: Es gibt eine Stelle [...} oder mehrere Stellen, die metrisch verrückt sind ..., humoristisch. Wie sehen Sie den Humor-Begriff bei Schumann eingelöst in diesem Werk?
S: Ja, Humor [...] Ich sehe dieses Werk nicht als humoristisches Werk, sondern Humor als [einen] Gemütszustand, als unterschiedlichste Gemütszustände. Es gibt lustige Teile von der Humoreske [steht auf und geht zum Klavier], so etwa wie diese Satz oder dieser [spielt weiter, geht dann zu seinem Platz zurück]... das ist so wie der Boogieman [Publikum, Bernhard Appel lachen] ... wie der, womit man die Kinder erschreckt. Wenn ihr nicht brav seid, dann kommt der Boogieman, wie sagt man das auf deutsch?
A: Knecht Ruprecht ...
S: Ja, also das [...] sind diese lustigeren Teile, aber humoristisch ist das nicht in diesem Sinne. Und solche Charakterzüge findet man auch in anderen großen Werken, ja auch in der Kreisleriana, auch in Davidsbündlertänze, auch in Carnaval, ja, das ist immer dieses kaleidoskopische.
A: Sie haben eben das aufregende, manchmal wirklich bizarr und verwirrend klingende Frühwerk angesprochen. Schumann hat ja dann später das gewissermaßen zurück genommen durch Neuauflagen, hat andere Fassungen vorgelegt, hat selber davon gesprochen, dass er da irgendwie kompositorisch überzogen hat. Ich weiß, dass Sie Schumanns Selbsteinschätzung an der Stelle nicht durchweg teilen, was die Fassung betrifft. Die frühen und die späten ...
S: Nein. Das ist sehr interessant bei Schumann. [...] Andere Komponisten – Schubert etwa ist ein gutes Beispiel: Schaut man sich die Frühfassungen oder die Skizzen von Schubert an und dann, [wo] er sich korrigiert hat, [...] ist er immer zu besseren Ergebnissen gekommen und ich finde, umgekehrt [ist es] oft bei Schumann. Er war natürlich fast krankhaft selbstkritisch und er war vielleicht nicht zufrieden und ... ich weiß auch nicht, man möchte jetzt wirklich die Schuld nicht an Clara geben, um Gottes Willen ... also ich hab eine ungeheuere Hochachtung für Clara Schumann und es war eine wunderbare Frau und eine wunderbare Künstlerin. Also ich weiß allerdings nicht, warum Schumann so oft seine Frühfassungen korrigiert und oft ganz geniale Ideen ausradiert oder verbessert hat. Sehr oft neige ich zu diesen Frühfassungen und ich komme zurück zur Frühfassung und das ist vielleicht musikwissenschaftlich nicht richtig. Viele Musikwissenschaftler machen mir das Leben schwer ... [Publikum lacht], nicht alle. Weil für die Musikwisschenschaft – und das ist auch richtig –, zählt die Fassung letzter Hand, nicht wahr?
A: Da hat sich allerdings ein Wandel vollzogen ...
S: Ja, gut ...
A: Es gibt also in der Editorik durchaus Ansätze, die Fassung früher Hand genauso ernst zu nehmen.
S: Ja und das ist wichtig, [und] es ist wunderbar in der Musikwissenschaft, dass man auch von verschiedenen Fassungen redet. Und man muss sie kennen. Aber ganz konkret. Die wunderbare C-Dur-Fantasie [op. 17] – das Titelblatt ist hier in der Vitrine – ist für mich ein Hauptwerk von Schumann, überhaupt ein Hauptwerk der europäischen Musikgeschichte, für mich [ist sie] das wunderbarste Liebesgedicht in der Musik. Und es ist sehr interessant. [...] Die ganze Welt kennt diese Fantasie und einmal kam zu mir ein wunderbarer Musiker, Charles Rosen, ein hervorragender amerikanischer Pianist und Musikwissenschaftler und einer von den intelligentesten Menschen, die ich je gesehen und getroffen habe. Damals lebte ich noch in Budapest und Charles Rosen kam zu mir und sagte, Sie leben in Budapest, ich habe davon gehört, dass im Nationalmuseum von Budapest eine Abschrift von der Schumann-Fantasie [existiert], mit einem ganz differenten, mit einem ganz anderen Schluss als den, den man kennt. Könnten Sie mir bitte davon eine Kopie schicken lassen. Das war damals sehr schwierig in Ungarn bei der kommunistischen Bürokratie, aber ich habe Glück gehabt und ich konnte dem Charles Rosen eine Kopie machen lassen und für mich auch. Und dieser Schluss ist ganz fantastisch. Ja, Sie wissen ja, da [steht auf und geht zum Klavier] im ersten Satz von der Schumann-Fantasie, das ist auch quasi ein Denkmal an Beethoven und [spielt] ein Zitat [spielt weiter] aus [Beethovens op. 98] An die Ferne Geliebte, [das Schumann] eben dann am Schluss des letzten Satzes [,...] in dieser Budapester Fassung [steht auf und kehrt zu seinem Platz zurück] wieder aufgriff. Ich werde Ihnen [diesen Schluss-Satz] dann [zum Ende der Veranstaltung] spielen, aber jetzt noch nicht ... [alle lachen] [Schumann} macht auf einem verminderten Septime-Akkord eine Fermata, dann ist Stille und aus dieser Stille ganz zauberhaft kehrt dieses Thema von Beethoven, dieses Beethoven Zitat An die ferne Geliebte zurück. Mit anderen Harmonien, ja anders koloriert mit wundersamen neuen Harmonien und damit schließt Schumann den Kreis. Das ist [...] so kreisförmig, um wieder bei Beethoven zu bleiben, wie der Schlusssatz aus der Sonate op. 109, wo Anfang und Ende sich treffen. Damit ist er wieder zurück in der Musikgeschichte, [bei den] Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach und dann hat Schumann das aber ganz eindeutig ...
A: gestrichen ...
S: ... diesen Schluss gestrichen, aber ich – also mea maxima culpa –, aber ich spiele diesen Schluss, weil er mich so berührt. Er packt mich einfach. Ich finde den bekannten Schluss von der Schumann-Fantasie sehr schön, aber verglichen mit dem Budapester Schluss [ist er] absolut konventionell, aber das stört niemanden. [Der Budapester Schluss] stört viele [lacht] ... und dann haben mir wirklich viele Musikwissenschaftler gesagt, das dürfen Sie nicht spielen, das hat der Schumann ausgestrichen, das ist nicht die Fassung letzter Hand. Dann habe ich eine Aufnahme gemacht mit beiden Schlüssen, ja, eine salomonische Lösung [alle lachen].
A: Nur vielleicht ganz kurz zur Erinnerung: Die Fantasie entstand im Zusammenhang mit der Planung des Beethoven-Denkmals hier in Bonn, es gab 1835 einen Aufruf, den Schumann selber verstärkt in der Neuen Zeitschrift für Musik aufgegriffen hat und seine Idee war, selber auch aktiv zu werden, das Projekt zu unterstützen und zwar mit einer Komposition, aus der dann eben diese Fantasie wurde. Sie finden in der Vitrine hier ... [deutet schräg vor sich] sowohl den Erstdruck mit dem Schlegel-Gedicht voran gestellt, und einen Titelblatt-Entwurf. Ich habe jetzt den Text nicht mehr genau im Kopf ... Obolen, also Spenden, auf Beethovens Monument und dann kommen Satzbezeichnungen, poetische Titel, das trägt damals noch die Opus-Zahl 12, am Rand steht hundert Exemplare, ich glaube für den Verein, das sollte also die Förderung sein. Wurde nichts draus. Um die Sache abzukürzen, das Denkmal brauchte auch lang, das kam dann erst 1845 zu Stande und als Schumann dann das Werk veröffentlichte, hat er es Franz Liszt gewidmet, der ihm dann später ja die H-Moll-Sonate sozusagen zurück geschenkt hat und die Beethoven-Spuren hängen natürlich mit diesem Denkmal-Gedanken zusammen. Es ist ja ... im Grunde eine Widmung, die musikalisch ausgesprochen ist durch das Zitat. Und ich finde es absolut überzeugend, die Versionen, die ja temporär irgendwann einmal gleichberechtigt waren für Schumann, [...] natürlich [auch] zu spielen.
S: Und auch autobiografisch, also die „ferne Geliebte“ und die Trennung von Clara – das ist wirklich eine Liebesbotschaft dieses ganze Stück. Übrigens hier diese Titel [deutet auf die Vitrine] wie „Trophäen“ oder „Palmen“ oder später „Sternbild“, das sind so wunderbare poetische Titeln, die mir dann sehr fehlen. Also es ist sehr gut, dass wir davon wissen, aber in den späteren Ausgaben und Fassungen hat er das alles systematisch ausgestrichen. Ich weiß nicht warum ...
A: Sie sprachen eben schon von Ihren Manuskript-Studien und ich weiß, dass Sie im Grunde jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um Handschriften zu studieren. Sie haben sich auch stark gemacht für Faksimile-Ausgaben, ich denke da an Dvořáks Klavierkonzert oder auch die Förderung der Faksimile-Ausgabe, beziehungsweise des Erwerbs der Diabelli-Variationen. Wenn Sie Manuskripte studieren, tun Sie das hoffentlich nicht, weil Sie den Musikwissenschaftlern misstrauen ...
S: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe wirklich einen sehr hohen Respekt für die Musikwissenschaften, ich habe sehr viele enge Freunde unter den Musikologen. Wir müssen auch wirklich Hand in Hand zusammen arbeiten. Es ist sehr schade, dass viele praktizierende Musiker so Angst vor der Musikwissenschaft haben, also Wissenschaft, Wissen, das ist nichts schlimmes [alle lachen]. [...] Viele praktizierende Musiker denken, ja, ach, nicht zu viel grübeln ... man muss schön instinktiv so los musizieren. [...] Ja, ich finde, dass das Instinktive in Musizieren dominieren muss, aber das Intellektuelle muss eine große Rolle spielen, wenn man große Musik spielt und hört. Das ist nicht [nur] einfach: Ach wie schön, ich lasse mich jetzt so mitreißen. Es gibt viele Dimensionen ...
A: Aber wenn Sie Handschriften studieren, ist natürlich die Aura des Originals faszinierend, das geht glaube ich allen so. Aber was hat das eventuell für eine Bedeutung für Ihre Interpretation? Ich meine, wir haben es ja bei der Fantasie gesehen, das hat ja Konsequenzen.
S: Ja, [es hat] Konsequenzen ... Ich liebe leidenschaftlich die Handschrift, ich fühle mich da in der Nähe des Komponisten. Das kann auch ein Brief sein. Obwohl das ist vielleicht sehr unhöflich, Briefe von anderen Menschen zu lesen, aber das tun wir heutzutage. Also das wird, ich fürchte, das wird jetzt aussterben, weil niemand wird die gesammelten E-Mails von x oder y lesen ...[alle lachen]
A: Das steht zu befürchten.
S: ... oder herausgeben. Oder vielleicht irre ich mich. Aber die Handschrift, das ist etwas wunderbares. Ich hab da sehr viel von Stefan Zweig zum Beispiel gelernt, diese Liebe zur Handschrift. Und das sind sehr unterschiedliche Handschriften, also [...] ich habe jeden Tag bei mir im Reisegepäck und zu jedem Konzert nehme ich eine Handschrift, ein Faksimilie von Bach mit. Das sind meistens zwei- und dreistimmige Inventionen oder der erste Band des wohltemperieren Klavier. Da gibts keine einzige Korrektur, das ist unglaublich. Das ist natürlich eine Reinschrift, aber man kann nur staunen. Also diese Mensch, wann hat er das gemacht und mit so vielen Kindern, die herum laufen [Publikum lacht] und schreien und brüllen und ich weiß nicht was und trotzdem das fertig zu bringen. Aber was mich bei Bach fasziniert in der Handschrift ist nicht nur die Makellosigkeit, sondern die Wellen, ja ... Wenn man jetzt eine moderne Notenausgabe nimmt, auch etwas sehr schönes und sehr wichtig, ist [...] alles so geometrisch klar und man hat gerade Linien und man tendiert dann, Bach auch so, ein bisschen so telegrafisch zu spielen. So daddadadda [gibt einen Takt vor]. Neue Sachlichkeit [Publikum lacht]. Schaut man dagegen die Handschrift an, so [sieht man], es sind Wellen, keine einzige gerade Linie, immer Wellen und die Musik strömt. Wie ein Bach oder wie das Meer, aber nie flach. [...] Dann ist es wiederum fantastisch, die Handschriften von Beethoven zu sehen, die sehr unterschiedlich sind. Also es ist wie ein Klischee zu denken, dass alle Handschriften von Beethoven sehr chaotisch sind. Manche sind es und manche sind unglaublich rein. Und oft bei den lyrischen Stücken, etwa wie die letzte Violinsonate op. 96. [summt], sieht man in der Federführung von Beethoven diese lyrische Zärtlichkeit. Diese männliche Zärtlichkeit, das ist sehr, sehr Beethoven eigen. Und dann es ist sehr wichtig zu sehen, bei Beethoven, bei Schubert, bei Schumann, [wie] manchmal [der] kompositorische Prozess [verläuft}. Wann wird korrigiert und wie und was sind die verschiedenen Stadien des Komponierens. Also das ist eine wunderbare Gelegenheit für uns Interpreten, was wir ausnutzen müssen. Und darum ist auch wieder wichtig die Zusammenarbeit mit der Musikwissenschaft, weil nicht wir sind wichtig, sondern Schumann ist wichtig, Beethoven ist wichtig, Bach ist wichtig. Also wir sind alle hier für sie. Da bin ich total überzeugt. Viele Leute sagen das ist ein Quatsch, [andere] sagen, ein Interpret ist ein Diener des Komponisten. Ich denke, das ist kein Unsinn. Ich schäme mich gar nicht, ein Diener von diesen großen Komponisten zu sein. Und dabei man hat immer noch seine Freiheiten und man muss den Notentext hundertprozentig, tausendprotzig respektieren. Also wo Schumann ein sforzando schreibt oder ein subito piano schreibt, da darf ich nicht ein subito forte spielen und umgekehrt. Aber trotzdem sind alle Interpretationen von diesen Meisterwerken unterschiedlich. Auch unter Interpreten, die alle den Notentext gewissenhaft folgen. So, ich finde, dass nicht die Gefahr besteht, dass es langweilig wird. Zum Beispiel der wunderbare Pianist Claudio Arrau hat in seinem Buch geschrieben, Ratschlag an junge Musiker, haben Sie keine Angst vor der Langeweile. Weil was heißt langweilig? Was vielleicht für eine Person langweilig ist, ist vielleicht für mich hochinteressant. Und das ist sehr gefährlich, wenn interpretierende Musiker jetzt sehr originell und sehr interessant sein wollen mit Absicht. Das geht immer in die Hose ...[Publikum lacht]. Das darf man nicht. Man muss Vertrauen haben in das Werk und in den Komponisten und nicht äußerlich und nicht plakativ interpretieren, sondern innerlich. Der inneren Stimme zu folgen ...

Cover der 2011 bei ECM erschienenen Doppel-CD von András Schiff mit Schumanns sog. Geistervariationen, Papillons op. 2, Klaviersonate Nr. 1 op. 11, Kinderszenen op. 15, Fantasie C-Dur op. 17 (auch mit einer 2. Fassung, der sog. Budapester Fassung des Schlussteils des letzten Satzes, die Sir András Schiff auch beim Schumann-Forum-Gespräch am 6. Juli 2016 im Bonner Schumannhaus spielte), Waldszenen op. 82