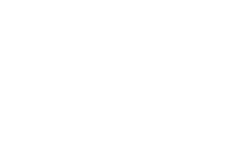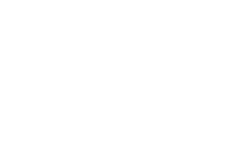Lieben Sie Schumann?
Boris Giltburg im Gespräch mit Christoph Vratz über Robert Schumann*
Schumann-Forum-Veranstaltung am 12. Dezember 2015 im Schumannhaus Bonn
* Leicht gekürzte Mitschrift des Gesprächs, das als Videodatei auf www.schumannportal.de online zur Verfügung steht. Die Textübertragung übernahm Eve Nipper, Firma Pergamon, das Lektorat Ingrid Bodsch. In [ ] gesetzte Angaben wurden nachträglich von Ingrid Bodsch eingefügt. [...] bezeichnet eine Auslassung im Text. ....bedeuten eine signifikante Pause im Gespräch. (I.B.)
V: Vielen Dank für die nette Begrüßung und auch von unserer Seite herzlich willkommen. Wir werden über Robert Schumann, den Komponisten, über Robert Schumann, dieses Phänomen im 19. Jahrhundert ein wenig sprechen und natürlich über den ganz persönlichen Zugang den Boris Giltburg zu seiner Musik entwickelt hat und wie es dazu überhaupt gekommen ist.
Herr Giltburg, im Jahr 2010, also im Schumann Jahr, stand in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, Schumann ist der erste Komponist der Moderne. Ist das etwas zu hoch gegriffen oder können Sie dieser zugespitzten Aussage etwas abgewinnen ...
G: Das ist ein interessanter Satz, weil – was ist das Moderne? Ist die letzte Sonate von Beethoven mehr oder weniger modern als Carnaval von Schumann? Also, wenn modern ist, was vorwärts schaut, also nicht ein Rückblick, sondern etwas, was noch nie gehört worden ist, dann ist sicherlich Schumann sehr modern. Ob moderner als Beethoven, das wüsste ich nicht zu sagen, ob moderner als Chopin kann ich auch nicht sagen. Aber ich würde sagen, dass von all diesen Schumann am frischesten ist. Also seine Musik, seine musikalische Sprache, seine Ideen sind so frisch, sie sind ein wenig wie frische Luft, die kommt […] Die Werke von Beethoven zum Beispiel, die sehr modern sind, wirken nie erfrischend …, sie sind manchmal etwas, wofür man viel Zeit braucht um sie zu verstehen, während bei bei Schumann, diese Frische, sie beginnt gleich mit der ersten Note, wenn man ... Entschuldigung ... [Boris Giltburg steht auf und geht zum Klavier im Hintergrund, Publikum lacht] ... hier also der Anfang von Carnaval ... [Boris Giltburg fängt an zu spielen]
V: Was ist diese Frische denn da? Ist es diese Akkordik, ist das dieser pointierte Rhythmus? Was macht diese Frische aus?
G: Es ist die ganz unbegrenzte und ganz ehrliche unaffektierte Fröhlichkeit für mich. Was aus einer Tiefe kommt, aber auch sehr jung, immer jung wirkt. Vor allem in den ersten Werken wie Papillons, Carnaval, Davidsbündlertänze. Ja sogar, wenn er etwas Dunkleres schreibt, wenn wir seine späteren Lieder betrachten, die sind manchmal sehr dunkel, aber trotzdem: sein Geist war immer jung ...
V: Würden Sie denn auch bei den Spätwerken – also spät ist ja relativ bei einem Komponisten, der nicht so alt geworden ist –, aber würden Sie auch beispielsweise bei den sog. Geistervariationen oder in den Gesängen der Frühe noch von einer Frische sprechen? Also diese Jugendlichkeit hat sich ja doch ein bisschen gewandelt ...
G: Gewandelt, ja, aber wenn man zum Beispiel die Drei Romanzen für Oboe und Klavier op. 94 nimmt, findet man trotzdem ein wenig von dieser Frische. Vielleicht war es da aber schon ein Rückblick und nicht etwas Neues. Wenn wir seine Werke betrachten – ie sind sehr, fast katalogisch angeordnet. Wir haben zuerst fast nur Klavierwerke, dann nur Lieder, dann die Sinfonien und so weiter, also es ist fast wie ein Fachkatalog. Für mich sind die Klavierwerke und die Lieder am jüngsten und am frischesten und besonders die Klavierwerke, die aus kleinen Stücken bestehen. Das war eine Form, die er selbst erfunden, entwickelt und fast, ja, ich würde sagen zur Perfektion gebracht hat, wie in den Papillons. […] Für mich ist er am Besten in diesen kurzen Stücken.
V: Diese Kurzform, die hat sich ja mehr oder weniger zeitgleich noch bei einem anderen Komponisten entwickelt, der vielleicht noch radikaler vorgegangen ist, das ist Chopin. Es gibt, glaube ich, selbst für Klavier, kaum einen Komponisten, bei dem auf so engen Raum so viel geschieht. Dagegen ist Schumann ja manchmal fast ein Epiker, etwas überzogen formuliert. Wir verorten Schumann immer in der Romantik, da gehört er hin, das ist sein Zuhause, das ist die Welt, in der er groß geworden ist. Was bedeutet für Sie als Interpret diese Romantik?
G: Zuerst nur eine kurze Sache zu Chopin, wenn man von ihm als jungen Komponisten spricht. Für mich ist Chopin unglaublich alt. Sogar in seinen frühen Werken, sogar wenn er viel Energie [versprüht], der Geist ist für mich immer „alt“, Chopin fühlt sich für mich als sehr weise an, als ob er sehr vieles schon gesehen hat und erfahren, erlebt hat ...
V: Aber ein Feuerkopf konnte er auch sein ... [lacht]
G: Ja, ja, im Grunde auch ..., aber für mich sind sie [Schumann und Chopin] an zwei Extremen dieser Strecke von jung zu alt.
Schumann als Romantiker ... Die romantischen Sachen sind für mich zuerst eine Mischung von Freiheit und Einbildungskraft, [...] ganz unbegrenzter Freiheit, das heißt, alles ist möglich. Und auch eine unbegrenzte Fantasie! Alles ist möglich, was den Klang angeht, was die Geschichte, die hinter der Musik steht, angeht, was den Wechsel angeht, in der Laune, in der Farbe, in der Melodie, in der Stimmung .... Auch … das Gefühl liegt viel näher zur Oberfläche als – jedenfalls für mich – in der klassischen Zeit, also bei Beethoven, Mozart und Haydn. Das Gefühl ist [bei Schumann] sehr spürbar, sehr stark, also unverschämt offen...
V: Das wäre ja tatsächlich wieder ein unglaublich moderner Komponist, wenn er so offen ist ...
G: Die Moderne ist für mich mehr die Scharfheit, manchmal auch der Ärger, die Unzufriedenheit … Prokofjew ist ganz modern ..., Schostakowitsch ist ganz modern. Und Schumann ist doch ein Romantiker.
V: Schumann ist ein Romantiker. Das hängt auch damit zusammen, dass er lange Zeit auch nicht wusste, in welche Richtung er sich bewegen sollte oder wollte. Halb zog es ihn zum Dichtertum – jetzt lassen wir mal außen vor, was vor allem seine Mutter aus ihm hat werden lassen wollen – und dann eben die Musik auf der anderen Seite. Gerade in den Frühwerken zeigt sich das ja auch. Wir haben eben über die Papillons schon ansatzsweise gesprochen. Wie ist das für jemanden, der nicht mit der deutschen Sprache als Muttersprache groß geworden ist, wenn man weiß, da hat Schumann unglaublich viel Lektüre, Einflüsse von Jean Paul verarbeitet. Geht man dann hin, aus Ihrer Warte und versucht diesen unsäglich komplizierten [Publikum schmunzelt], gedrechselt humorvollen Jean Paul zu entschlüsseln und ist nachher vollkommen resigniert und sagt, na ja, ich kann das sowieso nicht – ich kann Sie trösten, ich als Muttersprachler habe bis heute meine Schwierigkeiten mit ihm – oder wie gehen Sie davon?
G: Ich muss zuerst sagen, dass ich die deutsche Sprache zu lernen begann wegen der Lieder von Schubert, Schumann und Brahms und Mahler ...
V: Das ist ja nicht der schlechteste Grund ... [Publikum lacht]
G: Weil für mich Lieder meine Lieblingskammermusik sind. Und als Pianist, der mit einem Sänger oder mit einer Sängerin Lieder spielt, muss ich wirklich jedes Wort verstehen.
Die Texte von Jean Paul habe ich viel später gefunden und dann, ehrlich gesagt, nur die Teile davon gelesen, die Schumann in seinem Notizbuch niedergeschrieben hat als direkte Korrespondenz zur Musik. Und ich muss sagen, ich fand keine Korrespondenz zwischen diesen Stellen und der Musik selbst. Ich konnte fast nichts verstehen im Text und dann las ich nochmals und nochmals und als ich es verstanden habe, konnte ich trotzdem keine direkte Verbindung zur Musik finden.
V: Darüber gehen die Meinungen ja auch sehr durcheinander ...
G: Es gibt eine schöne Stelle, die ich doch …, also es ist nicht eine direkte Verbindung mit einem Text, den Schumann niedergeschrieben hat, aber Ergebnis einer wissenschaftlichen Recherche, dass eine Stelle in den Papillons eine direkte Verbindung mit einem Text von Jean Paul hat, wo er von einem tanzenden Schuh spricht. Und Schumann hat geschrieben, dass er einen tanzenden Schuh in fis-Moll höre und wenn ich diese Stelle spiele [Boris Giltburg steht auf, geht zum Klavier und fängt an zu spielen] – das könnte schon ein tanzender Schuh sein.
V: Da sieht man mal, was sie damals für gewichtige Schuhe getragen haben. [Publikum lacht, Boris Giltburg kehrt zu seinem Platz zurück]. Ich wollte das jetzt nicht sagen – holländische Klumpen … [lacht]
G: Ich finde aber, dass sich in der Musik von Schumann immer sehr viel Poesie befindet. Aber immer, wenn man es in genauere Worte, ob von Schumann selbst oder von Jean Paul, fassen will, dann wird die Musik einfach schwächer als wenn man sich einen reinen Zugang zur Einbildungskraft erlaubt und sich einfach in der Musik versenkt.
V: Es ist ja letztlich so, dass die Entsprechungen immer nur Näherungen sein können und auch sein sollen. Das ist ja auch seine Art zu verrätseln, mit Dingen auch bewusst rätselhaft umzugehen. Wir werfen hier ein bisschen fast schon leichtfertig mit Begriffen um uns, die ja für diesen Robert Schumann ganz wesentlich waren. Sie haben eben den Begriff Fantasie ins Spiel gebracht, und davor den Begriff Poesie. Was ist denn überhaupt diese Poesie?
G: Das kann ich einfacher zeigen... [Boris Giltburg zeigt über seine Schulter aufs Klavier]
V: Dann erklären Sie´s am Klavier ...
G: Ich wollte nur noch eine Sache sagen zur Verbindung zwischen Wort und Musik. Schumann selbst schrieb an Ignaz Moscheless über Carnaval. Er schrieb, dass er fände, das gesamte Werk sei von sehr geringem Wert. Das können wir gerne bestreiten ...
V: Das wissen wir heute besser, ja ...
G: Dann hat er gesagt, nur die verschiedenen Seelenzustände wären für ihn von Interesse. Da stimme ich ganz überein. Er wusste in zwei, drei musikalischen Sätzen sehr klar eine ganze kleine Welt zu schaffen. Ob es eine Charakterskizze, ein musikalisches Porträt oder eine Begegnung oder was auch immer war. Er schrieb [an Moscheles], dass er die Titel der einzelnen Stücke viel später hinzufüge und sich dann frage: Ist die Musik nicht immer an sich genug und sprechend?
V: Also, die Titelangaben bei Schumann, die Nähe von Wort und Musik, das greift ja manchmal ineinander ... Das vielleicht prominenteste oder offensichtlichste Beispiel ist ja das Schlussstück der Kinderszenen, wo es heißt „Der Dichter spricht“, aber es spricht natürlich keiner, es spricht die Musik. Aber wie er das dann macht, das ist so eine Mischung aus Choral und Rezitativ und Rezitativ ist ja dann schon wieder etwas Gesprochenes, aber das ist ja kein Einzelfall. Wir begegnen solchen Phänomenen ja oft ...
G: Also ich habe hier zwei Sachen zu sagen, zur Poesie und zu „Der Dichter spricht“. Das erste Werk, das ich von Schumann gespielt hatte als Kind – und da konnte ich eigentlich die Musik noch nicht so gut verstehen – war die Arabeske op. 18. Es gibt eine sehr schöne Geschichte zu ihrer Entstehung. [...] Schumann war damals in Wien und da hatte er eine Idee, Wien musikalisch zu erobern. Und zwar wollte er sich zum Lieblingskomponist von allen Wienerinnen emporschwingen und da hat er besondere Stücke für Frauen geschrieben. Der Versuch [alle Wienerinnen musikalisch zu erobern] gelang nicht und er kehrte [nach Leipzig] zurück. Aber unter diesen Stücken war die Arabeske und ob für Frauen oder nicht für Frauen geschrieben, sie gehört zu den Stücken [...] mit den meisten poetischen, lyrischen Seiten, die Schumann je geschrieben hat. Und [in diesen Stücken] finden wir einen Epilog und das ist für mich ...
G + V: [zusammen] „Der Dichter spricht“.
[Beide lachen, Boris Giltburg steht auf und geht zum Klavier]
V: Lassen Sie ihn sprechen.
[Boris Giltburg spielt „Der Dichter spricht“, Kinderszenen op. 15,13, Publikum applaudiert]
V: Wir können natürlich froh sein, dass es Robert Schumann nicht gelungen ist, alle Frauen von Wien für sich zu erobern. Umgekehrt ist es ihm gelungen, Millionen von Musikfreunden in den Jahrzehnten und Jahrhunderten danach zu erobern. Diese Schlusssequenz spricht ja für sich, da ist dieses rezitativische vorhanden. Ist dieses Sprechen in Tönen etwas, von dem Sie sagen, das lag Schumann so nahe, weil er so literaturaffin war?
G: Ein Dichter, also er war ein Dichter in der Seele und wenn wir seine eigene musikalische Verkörperung von Eusebius hören … [Boris Giltburg spielt Symphonische Etüden op. 13,5], da ist so viel drin, es ist fast wie ein Bildnis …[Boris Giltburg spielt weiter] Das ist unsymmetrisch, das ist nicht nur eine rein musikalische Weise, Musik zu schreiben ...
V: Erklärt das für Sie vielleicht auch, warum Schumann immer mit traditionellen Formen so seine Probleme hatte? Auch seine Sonaten, das sind ja mehr Fantasien …
G: Ich weiß. Ich finde, dass er in diesen kleinen Stücken genau wusste, wann man aufhören sollte. Er übertreibt nie. Sie sind genau so lang, wie er braucht, um eine einzelne musikalische Idee darzustellen, um ein Gefühl von Genugtuung und von Erfüllung zu geben und nicht mehr. Auch gibt es, zum Beispiel in Davidsbündlertänze, in diesen Stücken normalerweise fast keine Wiederholungen. Es geht immer weiter, es muss weiter gehen, weil es wie das Leben ist, das nie zurückkehrt. Aber wenn er manchmal doch etwas wiederholt, dann klingt und wirkt das so stark! Wie zum Beispiel dieses … [Boris Giltburg spielt]. Das ist die Nummer 2 aus Davidsbündlertänzen und dann in Nummer 17, also fast am Ende, heißt es „Wie aus der Ferne“... [Boris Giltburg spielt und summt]. Auch wie eine Erzählung oder ein Dialog ... [Boris Giltburg spielt und summt]. Dann geht es weiter ... und dann am Ende wiederholt er die Nummer 2 ... [Boris Giltburg spielt weiter]. Und das ist verträumt und dann spürt man etwas. In diesen kleinen Stücken hatte er doch so eine Idee von Struktur. Das war seine eigene Idee von Struktur, nicht die Sonatenform, nicht einmal die Variaitionenform, sondern seine eigene Form, die er früh gefunden hat – diese Reihe an kleinen Stücken, die sich doch zu einer Sache einen.
V: Fantasiecharakter eben. Fantasie, die sich immer spontane Wege sucht …
G: Aber sie ist interessant, diese Fantasie. Wenn man zum Beispiel eine ganz andere Sache hört, den ersten Satz von der dritten Sinfonie von Mahler, der ist 30 Minuten lang und es klingt …
V : Da bin ich gespannt ...
G: [lacht] … zuerst wie eine Sache nach der anderen, aber wie Teile eines Gebäudes, das dieser Satz zusammenhält und nicht in kleine Stücke zerbricht. Dann analysiert man und findet all diese Stückchen und alle diese Teile ... Oder den ersten Satz [...] der neunten Sinfonie von Mahler, da ist es noch komplizierter. Es ist das andere Extrem. Wenn wir hier [bei Schumann] die perfekte Form [...] in den kleinen Sachen finden, wie eine Perle, ist es bei Mahler [...] diese enorme Struktur. Aber als Zuhörer sieht hört man das zuerst nicht, weil es keine direkten Wiederholungen gibt und keine Exposition, Entwicklung und Reprise wie bei einer Sonatenform. Es klingt wie eine Melodie nach der anderen und doch haben wir immer ein sehr starkes Gefühl von Form, Struktur und das es doch um ein Werk geht und nicht um einen durchkomponierten Satz. Also ich glaube die Komponisten, sie wussten sehr genau, [was sie wollten], sie hatten eine sehr klare Idee, wie ihre Werke strukturiert werden sollten.
V: Das dürfen wir ihnen durchaus unterstellen, gerade den großen Komponisten, dass sie diese Vorstellung hatten. Es gibt da auch immer so eine Art Subtext, etwas Verbindendes. Ich weiss nicht, ob das jemals irgendwie systematisch nachgewiesen wurde, aber wenn man sich die Kinderszenen als Beispiel nimmt, da [wirkt] fast jedes Stück – nicht alle – aber die absolute Mehrheit der Stücke wirkt letztlich wie ein Choral. Das beginnt schon bei „Von fremden Ländern und Menschen“, wenn man das akkordisch spielen würde ... oder selbst ein verrücktes Stück wie den „Ritter vom Steckenpferd“, wenn man das langsam spielt, überall ist dieses Choralhafte drin, was dann nachher im „Der Dichter spricht“ auch wieder zum Vorschein kommt. Also insofern würde ich …
G: Ja, und manchmal hatte er, z. B. im Carnaval, dieses Motiv von vier Noten ... [Boris Giltburg spielt] diese A, S, C, H, das alles eint. Und manchmal erscheint dieses Motiv in einer Mittelstimme und doch es ist wie eine rote Linie, die sich durch das Werk – es dauert 27 Minuten – zieht ... Den Choral finden wir auch in den Davidsbündlertänzen ... [Boris Giltburg spielt]
V: Sie haben eben so nebenbei gesagt, das erste Stück von Schumann, das ich gespielt habe, war die Arabeske. Unsereiner, also mit anderen Worten die etwas weniger Begabten, die führen ein kümmerliches Dasein, wenn sie ein paar Stücke aus dem Album für die Jugend in den ersten Klavierjahren hinbekommen. Wie hat sich Ihr Verhältnis zu Schumann entwickelt?
[Boris Giltburg steht vom Klavier auf und kehrt zu seinem Platz zurück]
V: Also, ich darf kurz einflechten, es gibt in seiner Familie sozusagen ein Pianisten-Gen, weil nicht nur die Mutter war Pianistin …
G: Ja, auch die Oma und meine Urgroßmutter waren und sind Pianistinnen und Klavierlehrerinnen und deshalb haben wir immer ein Klavier zu Hause gehabt und ich wollte unbedingt spielen und meine Mutter wollte unbedingt, dass ich nicht spiele ...[Publikum schmunzelt]. Sie hat gesagt, wir haben zu viele Pianisten in der Familie und ich sollte etwas anderes versuchen ...
V: Das ist ja zum Glück richtig schief gegangen ...
[Publikum und Boris Giltburg lachen]
G: Wenn ein Kind mit fünf Jahren etwas sehr, sehr will und das nicht bekommt, dann will es das noch mehr und ich war so stur. Ich glaube, ich brauchte nur drei Wochen und dann gab mir Mutti den ersten Unterricht. Aber die Arabeske war die Idee meines ersten Lehrers und ich bin nicht sicher, dass es eine gute Idee für ein Kind mit acht Jahren war. Ich glaube, die Noten kann man spielen, aber es war wirklich, wirklich schwer.
V: Wie hat sich denn aus dieser ersten Begegnung mit Schumann, die ich jetzt nicht unbedingt als Liebe eines Achtjährigen zu einem Komponisten deklarieren möchte, wie hat sich denn diese Liebe zu Schumann entwickelt? Sie sprachen auch eben von den Liedern, die der Anlass waren, überhaupt die deutsche Sprache lernen zu wollen ...
G: Nach der Arabeske spielte ich Carnaval. Das war die Idee meines zweiten Klavierlehrers und ich bin auch nicht sicher, dass es eine gute Idee für ein Kind von zwölf Jahren war, aber dann mit 17 Jahren begann ich als Student in der Musikakademie in Tel Aviv und da hatten wir einen Liedbegleitungsunterricht und wurden in Paare aufgeteilt – also jeweils Sänger und Pianist – und am ersten Tag wurde uns nach dem Zufallsprinzip ein Lied gegeben, das wir zum nächsten Unterricht vorbereiten sollten. Und ich hatte doppelt Glück gehabt. Erstens, dass die Sängerin, mit der ich verbunden war, eine tolle Stimme hatte und ihre musikalischen Ideen ganz begeisternd waren. Und auch das Lied, das wir bekamen – es war „Zwielicht“ aus op. 39.
V: Das ist aber schon fast das modernste Lied.
G: Nicht nur ganz modern, sondern – ich bin ein Fan von Fantasieliteratur – es sprach zu mir ganz direkt, wirkte auf meine Einbildungskraft. Es war dunkel und farbenreich und es gab so viel hinter den Noten, es gab so eine interessante Welt, die ich entdecken wollte und erforschen.
V: Da bin ich ganz bei Ihnen ... Also einen „Larventanz“ von Jean Paul verstehe ich bis heute nicht, aber beim „Zwielicht“ hat man direkt einen ganz anderen Zugriff.
G: Also da begann meine echte Liebe zu Schumann, mit den Liedern und dann machten wir das Ganze, also den ganzen Liederkreis op. 39, dann mehr Lieder und dann spielte ich später Davidsbündlertänze, Papillons und das Klavierkonzert, und das sind alles bis heute Lieblingswerke.
V: Können Sie mir erklären, warum gerade bei Schumann es doch eine relativ große Diskrepanz gibt zwischen – bleiben wir bei den Klavierwerken – den sehr bekannten Stücken, die immer wieder gespielt werden, ob nun Kreisleriana, Carnaval oder dergleichen mehr und auf der anderen Seite dann wieder doch Stücke, die gerne schon einmal hinten über fallen. Also ich denke da an die Intermezzi oder auch die spätesten ...
G: Vier Märsche für Klavier op. 76 ...
C: Ja, oder auch die späten Stücke op. 111 [3 Fantasiestücke] und bei den Novelletten op. 21 ist es ja auch ...
G: … nur Nummer 8, die manchmal gespielt wird.
V: Ja. Aber das gibt ja doch eine deutliche Schieflage, denke ich. Oder würden Sie sagen, nein?
G: Nein, nein, das stimmt!
V: Aber warum?
G: Warum? Zuerst muss ich gestehen, dass ich nicht alle diese Werke gut kenne, die Sie gerade genannt haben. Und die ich doch kenne, die Intermezzi und die Novelletten, sind für mich vielleicht nicht – wenn man die von der Inspiration spricht – so inspiriert wie manche andere Werke von Schumann. Sie sind immer sehr gut, aber für mich fehlt etwas. Die Novelletten sind für mich ein wenig zu gearbeitet, die Struktur ein wenig zu, ja, zu nachgedacht, nicht so ..., also es wirkt nicht so spontan wie bei anderen Werken.
V: Würden Sie sagen, dass bei Schumann, gerade in den Klavierwerken es oft so ist, dass die Stücke, wenn er sozusagen nach einer Form sucht und sich irgendwie in die Tradition einpassen möchte – ich will nicht sagen, dass es schief geht, wir reden hier auf einem extrem hohen Niveau – etwas von ihrem spontanem Esprit, von ihrer Frische, von der Sie gesprochen haben verlieren?
G: [lächelt] Ich will etwas sagen. Wir betrachten das Werk von Schumann als „eins“. Aber für ihn, während des Lebens, da wusste er nicht, was er als nächstes schreiben würde und er könnte Ihnen nicht im Rückblick sagen, das war mein Weg für mich. Er musste diesen Weg finden mit jedem Werk und ich habe bei manchen Dichtern und auch anderen Komponisten [das Gefühl], es gibt Werke, die einfach besser sind, als andere.
V: Trotzdem ist Schumann einer der Komponisten, die nie sozusagen unter ihr eigentliches Niveau hinuntergepurzelt sind ...
G: Stimmt, stimmt!
V: Da gibt es doch andere Komponisten, bei denen das Gefälle größer ist ...
G: Vielleicht ist es auch so, dass manche Werke mehr Glück gehabt haben als andere, aber trotzdem, bei der Suche nach der Form – da ist für mich die Form von Papillons op. 2 schon perfekt, und dann Carnaval und Davidsbündlertänze, bei denen durch die Wiederholungen noch etwas dazu kommt. Aber Carnaval, Papillons – es ist dieselbe Form und es ist nicht besser oder schlechter, es ist, was es ist und es ist schon perfekt!
V: Ja!
G: Mit der Sonatenform gibt es doch mehrere Versuche, etwas eigenes zu finden und dann kommt er zurück zur klassischen, fast zur klassischen Sonatenform im Klavierkonzert und dann ist es am Besten. Es ist am einfachsten, am reinsten ...
V: Was ja auch ein bisschen seinem Weg entspricht, dass er mit zunehmendem Alter immer mehr traditionelle Formen auch für sich erschlossen hat. Was übrigens kein sehr schumannspezifisches Phänomen ist, sondern immer wieder auftaucht ...
G: Beim späten Brahms ist es umgekehrt. Oder vielleicht nicht?
V: Aber bei Brahms war es immer so, dass er sich für die alten Meister interessiert hat. Also er hat die alten Notenausgaben gelesen, selbst die der französischen Komponisten kannte er. Also Brahms ist da vielleicht ein Sonderfall. Aber nehmen wir vielleicht den späten Beethoven, wo Form wie Fuge und Variation und dergleichen mehr eine immer stärkere Rolle gespielt haben. Natürlich kannten die [Komponisten] sich aus. Und trotzdem ist es sehr häufig bei Komponisten, dass sie in ihren späten Jahren doch nochmals sozusagen die alten barocken Formen neu für sich erschlossen haben.
G: Vielleicht weil es, ja, weil die Fuge eigentlich keine Form ist, es ist mehr ein ...
V: Es ist aber auch kein Gefühl ...
G: Nein, nein ... kein Gefühl. Ich wollte sagen, es ist einfach eine Weise, Musik zu schreiben. Die Sonatenform hat doch sehr klare Teile – wir haben diese Expositionen mit erstem Thema, zweitem Thema, Zwischenteil und Codetta. Mit der Fuge ist es anders. Also wir haben Expositionen und ein Zwischenspiel, aber das ist so amorph, – also z. B. die große Fuge von Beethoven. Was ich meine ist, gerade weil es [die Fuge] so amorph ist und weil die Grenzen so unklar sind und so breit, kann Generation nach Generation von Pianisten etwas drin finden.
V: Ja, ich glaube aber auch, dass gerade die Komponenten wie Fuge doch auch etwas in sich bergen, was sich vielleicht auf einer abstrakteren Ebene abspielt … Ich möchte nochmals zurückkommen – wir sind eben davon abgewichen – auf Ihre persönliche Schumann-Laufbahn. Ich möchte doch einmal wissen, mit welchen Pianisten Sie sozusagen Ihr Schumann-Bild geschärft haben, also sprich als Hörer oder als Konzertbesucher ...
G: Also als Kind war es zuerst Horowitz mit der Arabeske, mit der Kreisleriana, Kinderszenen. Später Wilhelm Kempf mit manchen Sachen, auch mit der Arabeske, ganz, ganz anders. Als Sänger Dietrich Fischer-Dieskau und hier – wenn man von modernen Interpretationen spricht – seine Aufnahme von op. 39 mit Brendel, das ist sehr modern. Sehr klug, manchmal überklug ...
V: Ja, also gerade diese Aufnahme ist ihm ja oft um die Ohren geknallt worden, weil da angeblich Dr. Fischer-Dieskau gesungen hat ...
Er hat aber kein Risiko gescheut, selbst bei den hohen Tönen nicht. Es waren aber auch zwei Intellektuelle …
G: Ich weiß. Ich würde nicht sagen, es ist seine beste Aufnahme. Aber für mich klingt sie sehr modern.
V: Ja. Da bin ich ganz bei Ihnen. Mich wundert, dass vorhin bei den Pianisten, die Sie genannt haben, jetzt mit Ausnahme Horowitz, kein russischer Pianist dabei war. Es gibt ja beispielsweise einen Herrn Richter, der sich für Schumann sehr stark gemacht hat, aber auch immer sehr eigenwillig gespielt hat. Also die Fantasiestücke op. 12 hat er nie zusammenhängend gespielt.
G: Ja, eine kurze Umleitung ... Ich kenne keine Aufnahme von den Fantasiestücken, die mich wirklich überzeugt.
V: Von Richter oder jetzt von allen?
G: Von allen.
V: Warum? Woran fehlt es da?
G: Ich finde das Werk unglaublich schwierig. Schwieriger als Carnaval und Davidsbündlertänze.
V: Ja, warum?
G: Weil die Stücke schon ein wenig länger sind und manchmal ein wenig länger als sie vielleicht sein sollten. Vielleicht zu lang für das Material und dann muss man etwas machen. Aber auch, weil die musikalische Wahrheit doch tiefer unter der Oberfläche liegt.
V: Kann es vielleicht auch mit den Titeln zusammen hängen? Weil in den Fantasiestücken op. 12 habe ich oft das Gefühl, da helfen sie mir weniger.
G: [lacht] Beim Carnaval und auch Kinderszenen ist es so ähnlich wie bei Debussy in den Préludes – er wollte ja uns eigentlich gar nichts verraten und dann hat er es am Ende hingeschrieben und bei den Fantasiestücken „Ende vom Lied“ ...
G: Oder „Grillen“ ...
V: „Grillen“ ... ja. [lacht] Warum? Das ist auch so ein toller Titel. Also wie gesagt, bei op. 12 habe ich manchmal den Verdacht, dass die Titelbezeichnungen nicht so sehr helfen. Wenn beim Carnaval Chopin drüber steht oder Paganini, da wissen wir etwas damit anzufangen ...
G: Ja, klar. Vielleicht sind sie mehr als Keyword oder als Rätsel aufzufassen, als kleine Rätsel ..., die wir als Interpreten und vielleicht auch als Zuhörer enträtseln sollen. Also ich spiele das Werk auch, war aber nie damit zufrieden, was ich gemacht habe.
V: Nun [...] zählen ja auch die Fantasiestücke op. 12 zu den Werken, die – für einen Komponisten des 19. Jahrhunderts total ungewöhnlich – sehr oft, nicht immer, aber doch mit auffallender Häufigkeit im Nichts enden. Leise. Also nehmen wir die Papillons oder Kreisleriana oder eben op. 12, das „Ende vom Lied“, und die Reihe könnten wir jetzt fortsetzen ...
G: Davidsbündlertänze ...
V: Genau. Das ist ja eigentlich eine Hochrisiko-Nummer, die ein Komponist da fährt, in einem Zeitalter, wo das Virtuosentum gross geschrieben wird.
G: Das ist interessant. Könnte es mit der Tatsache zu tun haben, dass er wusste, dass er kein Virtuosen-Pianist sein würde? Aber bei den Papillons, da wusste er es vielleicht doch noch nicht … Er wollte ja Pianist werden, und dann kam diese dumme Geschichte mit diesem Apparat, den er benutzen wollte, um seine Hand größer zu machen und das hat dann so viel Schaden [angerichtet],dass er überhaupt nicht spielen konnte.
V: Natürlich, er wollte Pianist werden, aber er hatte dann ja auch eine Freundin, beziehungsweise spätere Frau an seiner Seite, von der er wusste, zu was sie fähig ist und trotzdem haben wir so oft diese leisen Schlüsse. Ist das ein Indiz dafür, dass er uns am Ende wirklich nur ungern in die diesseitige Welt – also sprich in die Welt des Virtuosentums – zurückholen möchte?
G: Also er konnte ja sehr virtuos schreiben ... Papillons op. 2, Carnaval op. 9, „Prestissimo“, das ist höchst virtuos. Und „Paganini“ auch. Vielleicht ist es aber so, dass er weniger Wert drauf legte, ob man am Ende Bravo schreit oder nicht. Vielleicht wurde er nicht bravo-süchtig ... [schmunzelt]. Ich weiss es nicht ... Mit Chopin ist es auch manchmal so ..., Chopin ist aber auch trotzdem ... [...]
V: Da kracht’s aber schon manchmal ganz gut bei Chopin und über Liszt brauchen wir gar nicht zu sprechen ...
G: Ja, ja, aber das interessante ist, dass Liszt das Ende von der Hammersonate, die auch mit dreifachem Forte enden sollte, völlig geändert hat und eine tiefe philosophische ...
V: Naja, das ist ja auch die formale Rundung, die Sonate beginnt ja auch ganz leise und es hat tatsächlich einmal den Vorschlag gegeben – bei einem Rundfunksender –, weil diese Sonate doch am Anfang und am Ende so leise sei und um das Stück populärer zu machen, dass man das doch einfach abschneiden möge …[Boris Giltburg und das Publikum lachen] ..., dann sei das auch fürs Auto fahren durchaus geeigneter. Ich lass diese Anregung einfach mal stehen. Von diesen leisen Schlüssen möchte ich noch einmal zurück zum schumannspezifischen Klangbild, das Sie ja jetzt schon in mehreren Facetten beschrieben und auch gespielt haben. Wenn man einen Blindtest machen würde, also beispielsweise bei „Wer wird Millionär“ und man würde vier verschiedene Notenausgaben auf den Tisch legen und eine davon wäre Schumann. Ich glaube, dass man Schumann immer – nicht immer, aber doch sehr oft – relativ gut erkennen kann, wegen der Mittelstimmen.
G: [zustimmend] Hmmm ...
V: Das ist etwas völlig Neues ...
[Boris Giltburg steht auf, geht zum Klavier und spielt]. Es ist immer, also fast immer dreischichtig und sogar im „Eusebius“, wo es ganz unten um die Melodie geht, aber sogar da ... [spielt weiter]. Also sogar wollte er eine kleine Linie, also Zwischenstimme von vier Noten hinein setzen. Es ist sehr, sehr prominent.
V: Natürlich gibt es das auch bei anderen Komponisten der Zeit, bei Liszt, aber Schumann betreibt das schon sehr exzessiv im Grunde. Ist das sein Weg einer neuen Musiksprache?
G: Vielleicht. Aber dann hat er das sehr früh gefunden, weil schon am Ende von Papillons, hat er diese unglaubliche Vielschichtigkeit ... [spielt weiter]. Also wir haben eine Bassnote für 26 Takte ... [spielt weiter]. Hier haben wir den „Großvater-Tanz“ ... [spielt weiter]. Wir haben den „Papillons Walzer“, also drei Schichten ... [spielt weiter]. Und dann drauf noch a’’’ ... [spielt weiter]. Und die Note sollte noch klingen. Also er hat sehr früh seine Musiksprache gefunden.
V: Deswegen habe ich ein bisschen geschmunzelt, als Sie Gustav Mahler ins Spiel brachten, weil bei den Orchesterkomponisten ist es in meinen Augen Gustav Mahler, bei dem so vieles gleichzeitig passiert, dass man manchmal das gar nicht auseinander halten kann – und manche Dirigenten sowieso nicht. Deswegen möchte ich aber jetzt nochmal von den Mittelstimmen zurück zu einem Phänomen der damaligen Zeit, nämlich dem Klavierbau. Ich glaube, dass unsere Flügel heutzutage nicht immer dazu geeignet sind, diese Transparenz herzustellen, die Schumanns Musik braucht. Wie sind Ihre Erfahrungen mit historischen Flügeln?
G: Also ich kenne mehr die „älteren“. Ich habe ein Jahr Hammerklavier studiert. Aber es waren mehr die Instrumente aus der Zeit von Mozart und frühem Beethoven, also nicht aus der Zeit von Schumann. Die kenne ich nicht so gut. Also ich habe einmal auf einem Instrument von Chopin gespielt, einem Erard aus den 1840ern. Aber das fand ich sehr seltsam und sehr ungeeignet für Chopin …
V: Hat er vielleicht auch gedacht, aber er hatte keine Alternative ... [Publikum lacht]
G: Ja, das ist wahr. Aber wenn wir Zeugnisse lesen von Leuten, von Zuhörern von Chopin, so soll er ein unglaubliches Legato gehabt haben, so verbunden und so weich, wie eine Malerei. Und wenn er das auf so einem Erard machen konnte – es ist unglaublich. Es ist ein trockenes Instrument, sehr, sehr detailliert ...
V: Ja, die Anschlagmöglichkeiten waren eben andere zu der Zeit, es war eine andere Besaitung und dementsprechend ein anderer Klang. Dennoch glaube ich manchmal, dass dieser Blick durch die historische Brille unser Hörempfinden oder unser Bewusstsein für die Möglichkeiten, unter denen die Komponisten damals haben schreiben müssen, doch auch verändern kann. Sind Sie eigentlich ein enzyklopädisch denkender Mann, der sagt, ich habe jetzt diese und jene Station bei einem Komponisten – in diesem Fall Schumann – durchschritten und jetzt möchte ich weiter gehen und sozusagen das Spektrum vielleicht so erweitern, dass sich eines Tages da mal ein Gesamtwerk draus ergibt? Oder sagen Sie einfach – Sie haben eben Horowitz erwähnt, der sich nie um irgendetwas enzyklopädisches gekümmert hat, das hat ihn nicht die Bohne interessiert –, dass das nicht in Ihrem Sinne liegt?
G: Ich habe zuerst die Frage falsch verstanden. Ich habe gedacht, dass Sie fragen, ob ich das auf einem historischen Instrument machen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, was mich mehr interessiert, ist die Vielfalt der Instrumente heute. Also einen Bösendorfer wie heute [im Schumannhaus steht ein Bösendorfer Flügel aus 1980-er-Jahren] oder Steinway oder Fazioli – es gibt sehr viel zu versuchen und zu finden. Ob es ein Instrument gibt, das besser für einen wäre oder das für einen Komponisten geeigneter ist oder nicht. Oder ob es eine persönliche Wahl ist. Es gibt kein besser oder [schlechter], aber …
V: Wollten Sie dann sagen, dass von den heutigen Instrumenten ein Klavierbauer dem, was Sie sich unter Schumanns Musik vorstellen, sehr nahe kommt?
G: Nein. Ich fühle, dass wir eine lange Zeit hatten mit nur einem Klang, eine Klangwelt. Das war die Klangwelt von Steinway. Und das war ein Monopol. Und ich fühle, dass wir vielleicht jetzt am Beginn einer Zeit mit mehr Vielfalt leben. Wir haben Fazioli mit einer ganz anderen Klangästhetik und wir haben die neuen Bösendorfer, also die mit Yamaha zusammengebauten, die sind sehr interessant und auch anders, mit der Persönlichkeit von einem Bösendorfer, aber auch mit dem modernen Gefühl des 21. Jahrhunderts. Und Yamaha hat seinen eigenen Konzertflügel. Der ist auch interessant. Ich habe ihn nur einmal gespielt, er war so orchestral und auch für Polyphonie ganz gut geeignet, man konnte ohne Bemühung die Stimmen ganz leise teilen und voneinander trennen. Also ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht am Anfang von etwas Neuem sind, was die Klaviere angeht.
V: Das Problem sind ja dann oft die Kosten. Nämlich die Konzerthäuser haben ihren Steinway da stehen und ohne Not geht man nicht hin und kauft jetzt noch einen Fazioli oder einen Bösendorfer dazu ...
G: Das stimmt. Aber manchmal kann man direkt mit Fazioli oder mit Bösendorfer oder mit Yamaha Kontakt aufnehmen. Sie würden sehr gern ein Klavier zur Verfügung stellen für ein Rezital und dann hat man die Möglichkeit zur Auswahl. Und es gibt auch Säle, wo man eine Wahl hat zwischen verschiedenen Firmen. Oder sogar zwischen zwei Steinways und die können auch sehr verschieden sein.
V: Die können auch unterschiedlich sein, ja ...
G: Und ich sehe auch, dass es in Konzertsälen nicht mehr nur Steinways gibt, die gespielt werden. Und das finde ich auch gut … Ich hoffe, es wird Steinway auch ein wenig Inspiration geben, auch etwas Neues zu machen.
V: Ja, in diese Richtung sich zu bewegen. Jetzt sind Sie elegant der Frage ausgewichen nach dem ...
G: Ach ja ... nein, nein ... [lacht] Das war die [Frage nach dem Enzyklopädischen], die ich falsch verstanden habe. Nein, also enzyklopädisch würde ich mich persönlich, also heutzutage, Rachmaninow, Brahms, Ravel [nähern].
V: Warum diese drei? Weil ich den gemeinsamen Nenner jetzt spontan nicht finden könnte ...
G: Ravel, da es kein Werk von Ravel gibt, das ich nicht gern habe und das gesamte Werk von Ravel ist ...
V: Es ist überschaubar groß ...
G: Zwei bis zweieinhalb Stunden, im Vergleich zu Debussy zum Beispiel, bei dem ist es wenigstens zwei mal soviel. Bei Brahms, besonders junger Brahms und später Brahms. Also die Variationen Händel und Paganini vielleicht noch nicht, aber die ersten Sonaten … und die Balladen ... es ist der junge Brahms. Und das alles entstand in drei Jahren. Er war 19, 20, 21, 22 ...und dann der späte Brahms ...
V: Die Klavierstücke ...
G: Ja. Und Rachmaninow, er ist mein Lieblingskomponist und es gibt auch sehr wenige Werke, die ich nicht gern habe.
V: Das klingt schon fast wie ein Schlusswort und ein perspektivischer Ausblick. [Boris Giltburg lacht und kehrt zu seinem Stuhl zurück].
Ganz so leicht möchte ich es Ihnen dann aber doch nicht machen.
Vor allem möchte ich die Gelegenheit nutzen, das Publikum zu animieren, Fragen zu stellen, weil ich mir vorstellen kann, dass doch das eine oder andere sich im Laufe der letzten Stunde ergeben hat, was ihnen jetzt auf der Seele brennt und was sie vielleicht los werden möchten
[Christoph Vratz sieht auffordern ins Publikum, Publikum lacht, kurzes Schweigen – Boris Giltburg lächelt]
V: Das ist noch etwas verhalten, aber ich bin ziemlich sicher ...
[Publikum lacht, kurzes Schweigen – Dame links im Vordergrund beginnt]. Vielleicht nur im Zusammenhang mit dem enzyklopädischen – das kann ich schon verstehen, dass man von bestimmte Musikern, von denen es, wie Sie ja so schön sagten, eigentlich nichts gibt, was man nicht mag …
G: Ja, ja, genau ...
... dass man das als Musiker auch gerne alles musikalisch ausdrücken möchte ...
G: Das fand ich zum Beispiel bei den Werken von dem jungen Brahms, die habe ich für mich erst in diesem Jahr entdeckt ... Also das heißt, vielleicht ändert sich die Situation in einigen Jahren wieder.
V: Der Hintergrund meiner [ursprünglichen] Frage war auch ein etwas anderer, weil wir ja gerade in den letzten Jahren etwas erlebt haben, was in dieser Häufigkeit bis dahin nicht existent war, nämlich Schumann komplett zu erschließen. Wir haben zwar früher Arrau gehabt oder Kempf, die zwar sehr viel gespielt haben und es gab auch – Stichwort Jörg Demus – den einen oder anderen Pianisten, der versucht hat das ganze Werk einzuspielen, aber in den letzten Jahren – Florian Uhlig oder eben Éric Le Sage – und es gäbe noch zwei, drei andere, die den Ehrgeiz entwickelt haben, uns diesen Schumann als Paket dahin zu stellen. Und da zielte meine Frage in die Richtung, ob Sie auch von diesem Ehrgeiz – der vielleicht manchmal auch ein rein sportlicher Ehrgeiz sein mag – [ergriffen] sind.
G: Zuerst eine Frage als Antwort. Könnte es sein, dass mit Schumann – vielleicht auch mit anderen Komponisten – , dass der Unterschied zum Beispiel zwischen Kreisleriana und Carnaval so groß ist, dass es vielleicht für einen Pianisten nicht leicht ist, alles wirklich gut spielen zu können. … Ich empfinde das z.B. bei den Sinfonien von Mahler. Natürlich gibt es viele Aufnahmen mit allen Sinfonien von Mahler. Aber wenn ich persönlich eine Liste machen sollte von den besten Symphonien, von den besten Aufnahmen – da würden vielleicht zwei von Bruno Walter oder Klemperer draufstehen, aber alle 9 oder 10 nur von einem als die besten, das existiert nicht, glaube ich …
V: Das wäre bei Schumann, denke ich, auch sehr ähnlich.
G: Zum Beispiel Rachmaninow finde ich viel homogener. Also es gibt viele Entwicklungen zwischen dem ersten Klavierkonzert und den symphonischen Tänzen, aber wenn für einen die Musik von Rachmaninow nahe liegt, dann, würde ich sagen, fast die ganze Musik von Rachmaninow. Was vielleicht bei Schumann nicht der Fall ist.
V: Manchmal zerschlagen sich ja auch Projekte. Cyprien Katsaris hat auch gesagt, wenn er mal einen Wunsch hätte, dann wäre es auch, den ganzen Schumann aufzunehmen. Und dann ist das Projekt auf halber Strecke stehen geblieben. Und bei anderen Pianisten, bei Schiff zum Beispiel ist es ja so, dass er nie das Ziel hatte, das Werk Schumanns komplett zu erschließen und trotzdem kommt so alle drei, vier Jahre ein neuer Konzertmitschnitt, wo dann wieder Schumann-Werke eingespielt worden sind und so allmählich rundet sich das auch immer mehr.
G: Vielleicht hatte er das so im Hinterkopf ...
V: Aber er ist ja auch einer dieser Enzyklopädisten, der den Bach komplett eingespielt hat und dann nach vielen Jahren Beethovens und Mozarts Klavierkonzerte und Sonaten und dergleichen mehr und Schubert ... In diese Richtung zielte dann eben auch meine Frage.
G: Ja, verstehe ich. Für mich persönlich ist es momentan so, dass es bei Schumann die Werke sind, die ich bis jetzt gespielt habe und langsam werden es vielleicht mehr.
V: Bleibt die Frage ins Publikum nach den Fragen. [Boris Giltburg, Christoph Vratz, Publikum lächeln]
Ein weiterer Zuhörer:
Ja, [ich habe] eine Frage zum Rhythmus. Schumann verunklart ja immer den Taktschwerpunkt ... es schwebt ... und das ist ja immer als Musiker und als Hörer manchmal gar nicht einfach, festzustellen, wo ist denn jetzt eigentlich der Taktschwerpunkt. Für mich ist also die Frage, will Schumann das wirklich verunklaren oder nur, sagen wir mal, schemenhaft die Taktschwerpunkte noch erkennbar machen und wie geht man damit als Musiker, als professioneller Musiker um?
G: Ich kann sofort ... [Boris Giltburg deutet auf den Flügel, steht auf, geht hin]. Also diese Stelle, die wiederholt er in Davidsbündlertänzen. Also es ist in 6, 8 ... [spielt]. Aber es klingt gleichzeitig in 3, 4 und dann haben wir, weil alles wiederholt wird, die Möglichkeit, das zweimal unterschiedlich zu spielen. Wir können also zum Beispiel zum ersten Mal ... [spielt und erläutert] Also ganz in drei ... [spielt] Und dann in zwei ...[spielt] Oder dann ... [spielt]. Es ist nicht besser oder wir sind sogar sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, und dass es auch im Notentext steht, also so geplant war. Also er schreibt es als verschiedene Stimmen. Es ist nicht nur in unseren Ohren, er hat es so gedacht. […]
Zuhörer: Ich komme nochmal zurück auf den Anfang ihres Gesprächs, da erwähnten Sie den Einfluss von Jean Paul auf das Klavierwerk von Robert Schumann. Dem bin ich mal begegnet anlässlich einer CD Ihres Kollegen Stefan Mickisch. Ich darf davon ausgehen, dass Sie diese Einspielung, diese Tonaufnahme kennen?
G: Persönlich.kenn ich Herrn Mikisch, aber nicht die CD.
Zuhörer: Unter diesem Thema „Der Einfluss von Jean Paul auf das Klavierwerk“ von Robert Schumann habe ich einmal mit meiner Frau versucht, das auf uns einwirken zu lassen. Wir hatten große Schwierigkeiten. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass ich nach dem Gespräch, für das ich sehr dankbar bin, dass ich da eher einen Zugang finde. […]
G: Also es gibt sehr interessante Sachen, alle diese Fragen betr. den Papillons oder die Sphynx aus Carnaval. … Aber die Frage ist dann, was machen wir damit als Interpreten. Sollen wir das anders spielen? Es ist die Frage, sollen wir einen Takt von Bach anders spielen, weil wir wissen, dass es Takt 41 mit 14 Noten und da auch das Motiv B, A, C, H erscheint. Aber das ist mitten in der Phrase, was sollen wir mit dieser Innovation machen …
V: Das ist ja der Vorteil bei Musik, da ergeben sich verschiedene Berufsgruppen draus ... [Boris Giltburg und Publikum lachen]. Die einen zerklamüsern das und die anderen setzen sich hin und setzen das praktisch um. Und das finde ich durchaus einen Vorteil dieser Disziplin.
G: Ja, ich glaube auch. Für mich persönlich muss es immer von der Musik, vom Geist der Musik kommen. Ein Programm kann man nicht aufsetzen, sogar wenn das Programm im Kopf des Pianisten stand. Aber wenn man das als Interpret nicht organisch fühlt – ich finde, das geht gegen der Natur ...
V: Ich möchte Ihnen eher helfen, es klingt nur wie ein Widerspruch. ... Sie haben gesagt, ich möchte den Geist der Musik erfassen, abbilden. Ich glaube aber einfach – Sie haben ja eben auch versucht, die Bezüge zu Jean Paul ansatzweise herzustellen –, dass Sie nicht nur den Geist der Musik, sondern den Geist des Ganzen, also sprich den biographischen Hintergrund, den historischen Hintergrund einbinden. Und da ist ja Jean Paul, wie ich finde, ein Paradebeispiel, selbst wenn wir – und ich zähle mich dazu –, diese Lektüre heute als äußerst schwierig empfinden. Wir wissen aber doch zumindest, dass es auch darum geht, eine bestimmte Form von Humor zu entwickeln und wenn Sie in der Lage sind, diesen Humor pianistisch zu vermitteln – und das sind Sie –, dann ist ja dieser Geist schon in einer gewissen Weise bereits erfasst und abgebildet und so hilft es letztlich dann ja doch wieder, wenn wir das eine mit dem anderen wieder verbinden. Zumal eben die Romantik die Epoche war, in der die verschiedenen Künste erstmals so eng miteinander verzahnt wurden, wie es vorher eben nie war.
Zuhörerfrage:
Ich habe da eine ganz andere Idee zu den Beziehungen zwischen Rhetorik und Musik, da es eben in früheren Zeiten eine ganz enge Beziehung zwischen rhetorischer Regelhaftigkeit und musikalischer Regelhaftigkeit gegeben hat. Das alles ist im Sturm und Drang aufgebrochen worden. Denken wir an Carl Emanuel Bach. Und das selbe passiert ja auch in der Literatur und Jean Paul ist ja ein Beispiel. Da gibts keine Regel ...
G: Ich habe gerade an die dreifache Wiederholung gedacht. Wenn da Sequenzen steht, sagen wir normalerweise immer, nicht mehr als drei Wiederholungen und das gilt auch auch in der Literatur. Ich habe gelesen, dass man auch heute sagt, wenn man eine Idee unterstützen will, dann sind drei Wiederholungen am besten. Besser als zwei, besser als vier. Wenn wir manchmal die vierte Wiederholung bei Beethoven finden, dann fragen wir, ist das wirklich nötig? Also es ist auch eine kleine Verbindung zwischen Rhetorik und Musik, aber das sind nur Fragen von mir, keine Antworten ...
V: Das ist wunderbar. Es sind nur Fragen und keine Antworten. Dabei haben Sie uns so viele Antworten gegeben und in diesem Sinne tragen wir doch all diese Fragen mit uns nach Hause. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Antworten in Wort und Ton.
G: Vielen, vielen Dank.
[Publikum applaudiert, Boris Giltburg und Christoph Vratz erheben sich, geben sich die Hand]